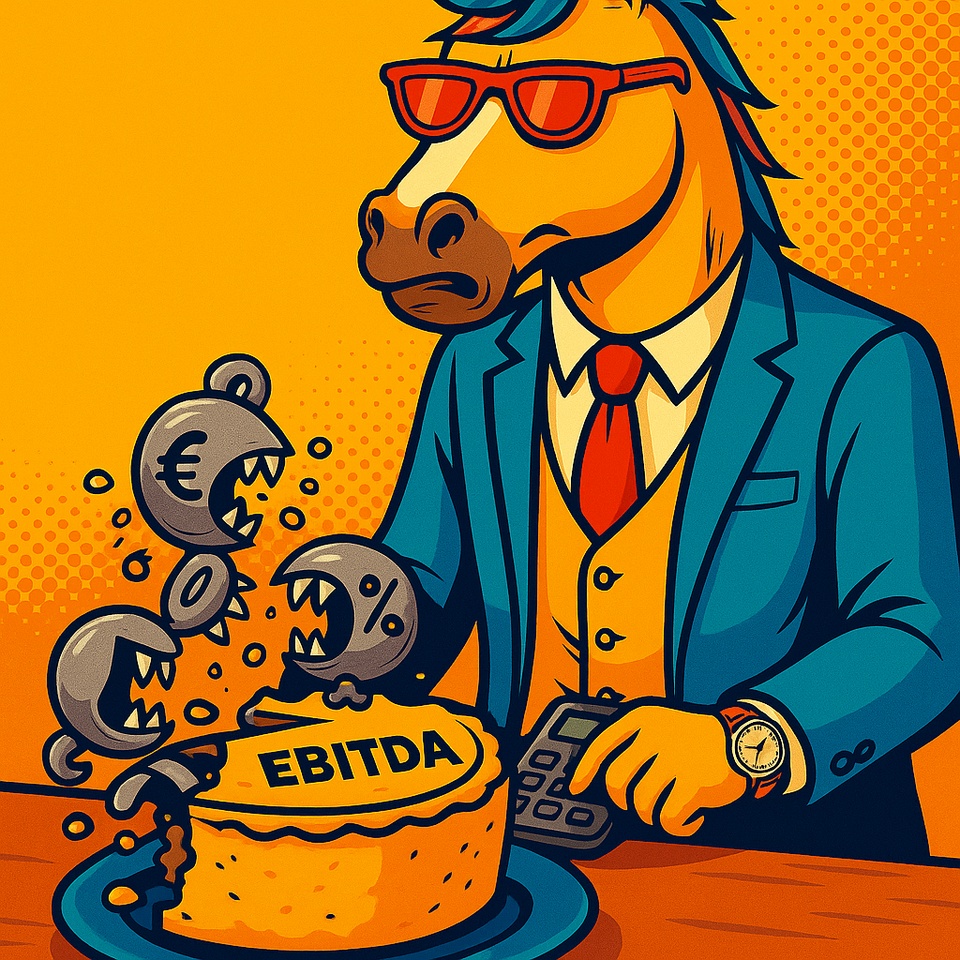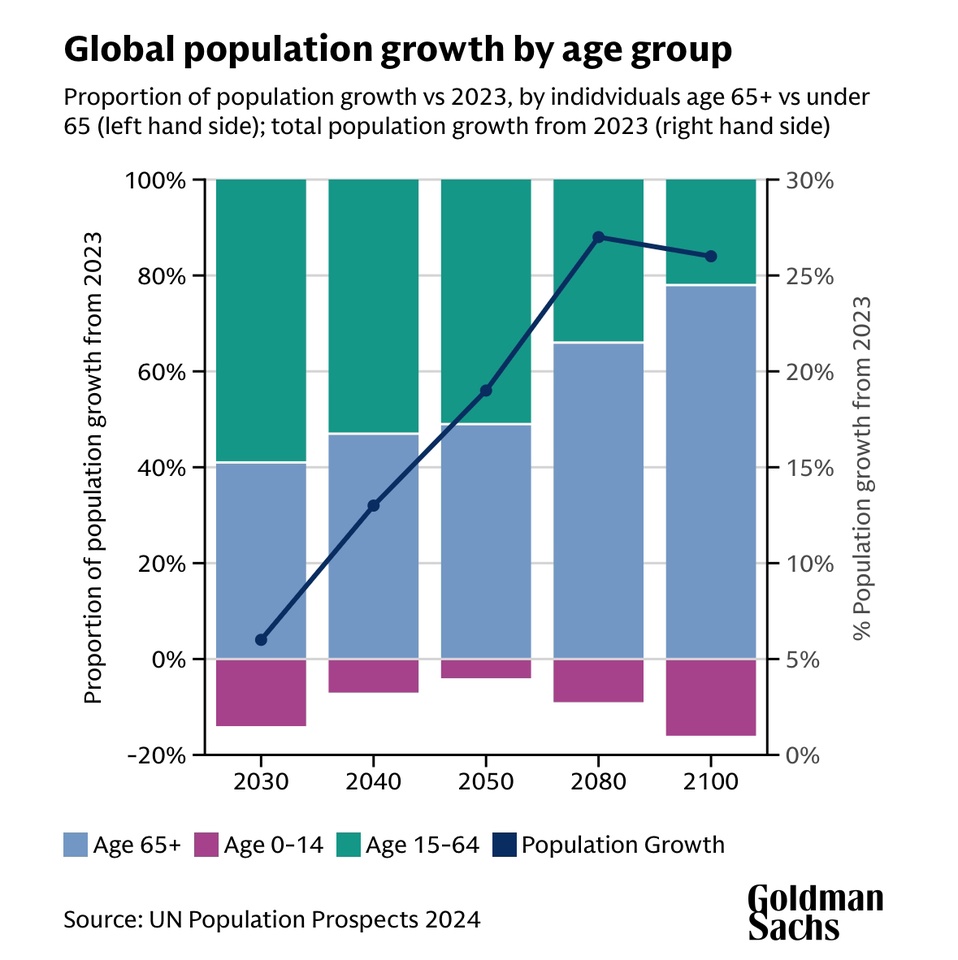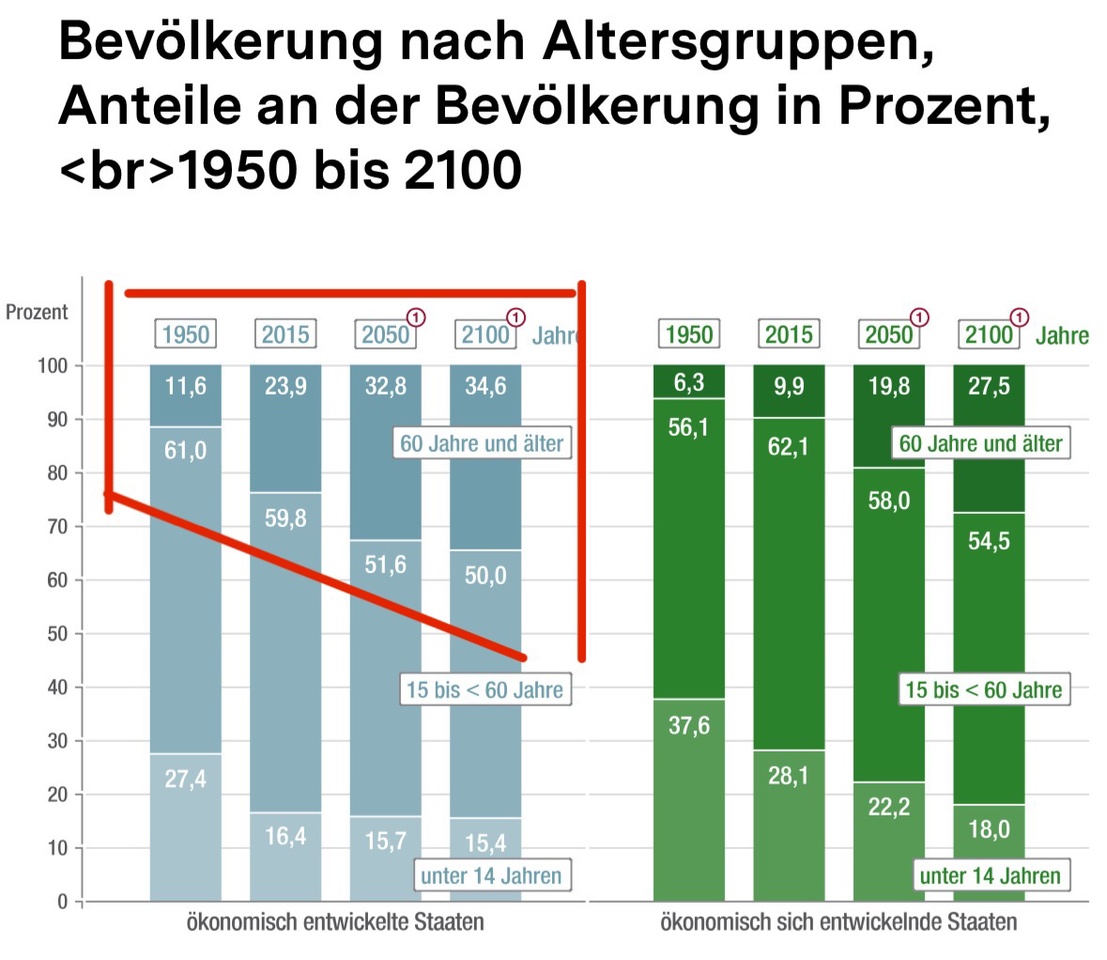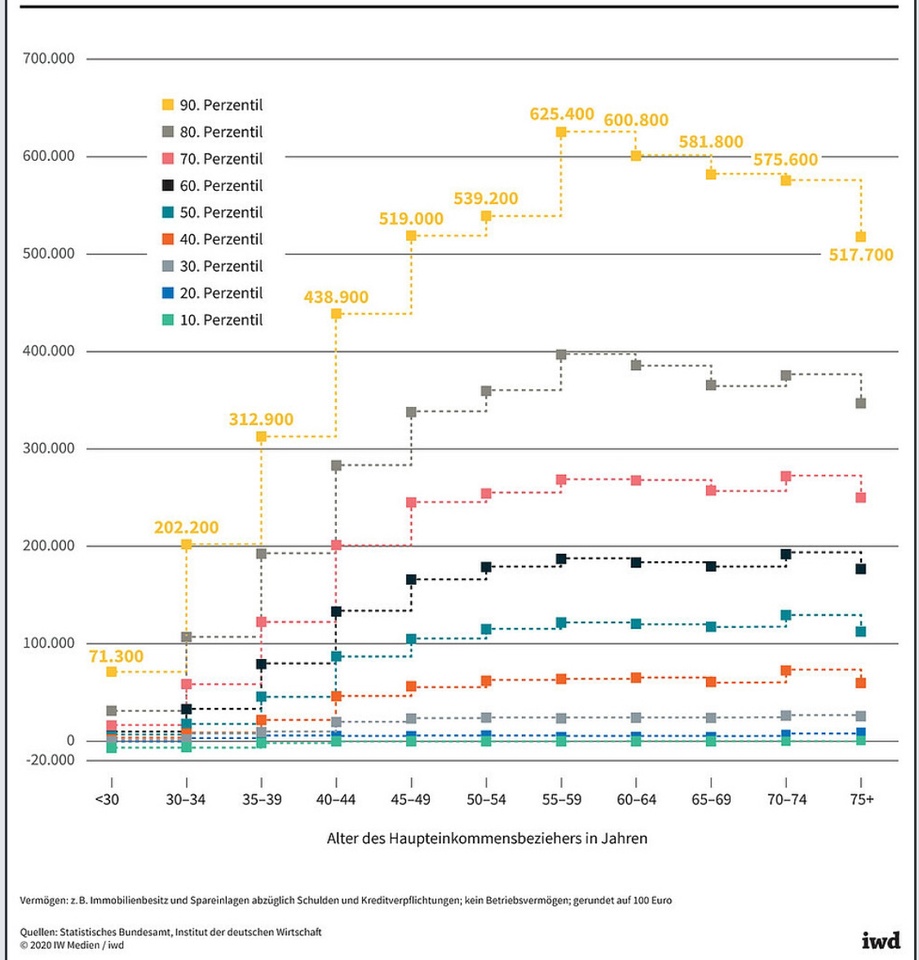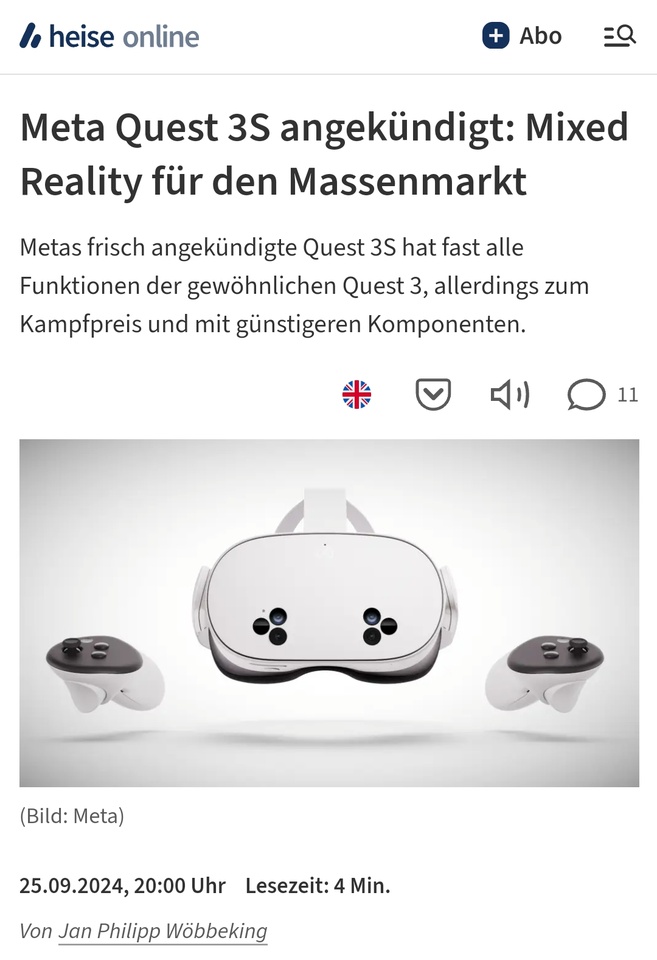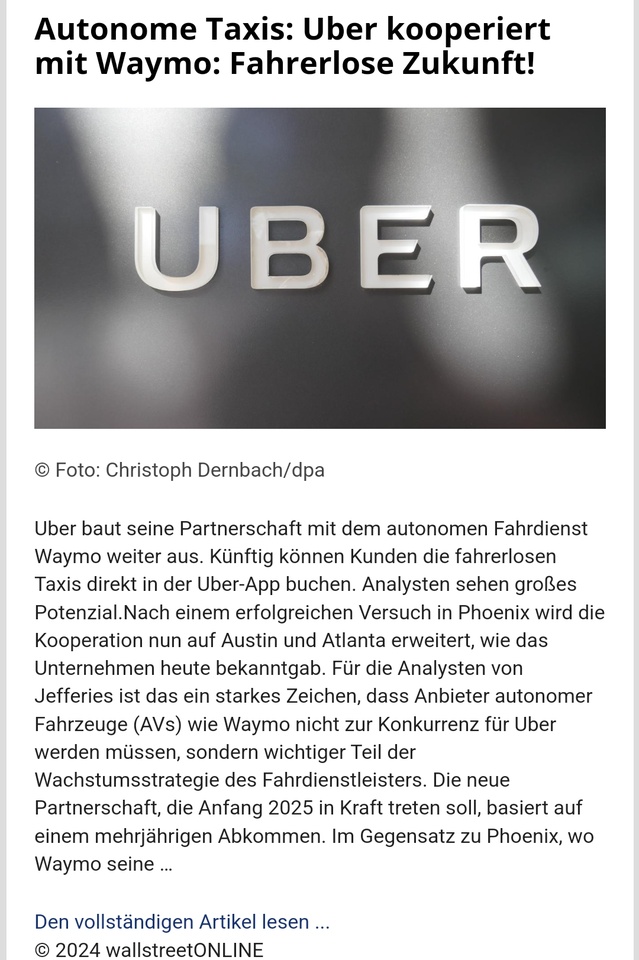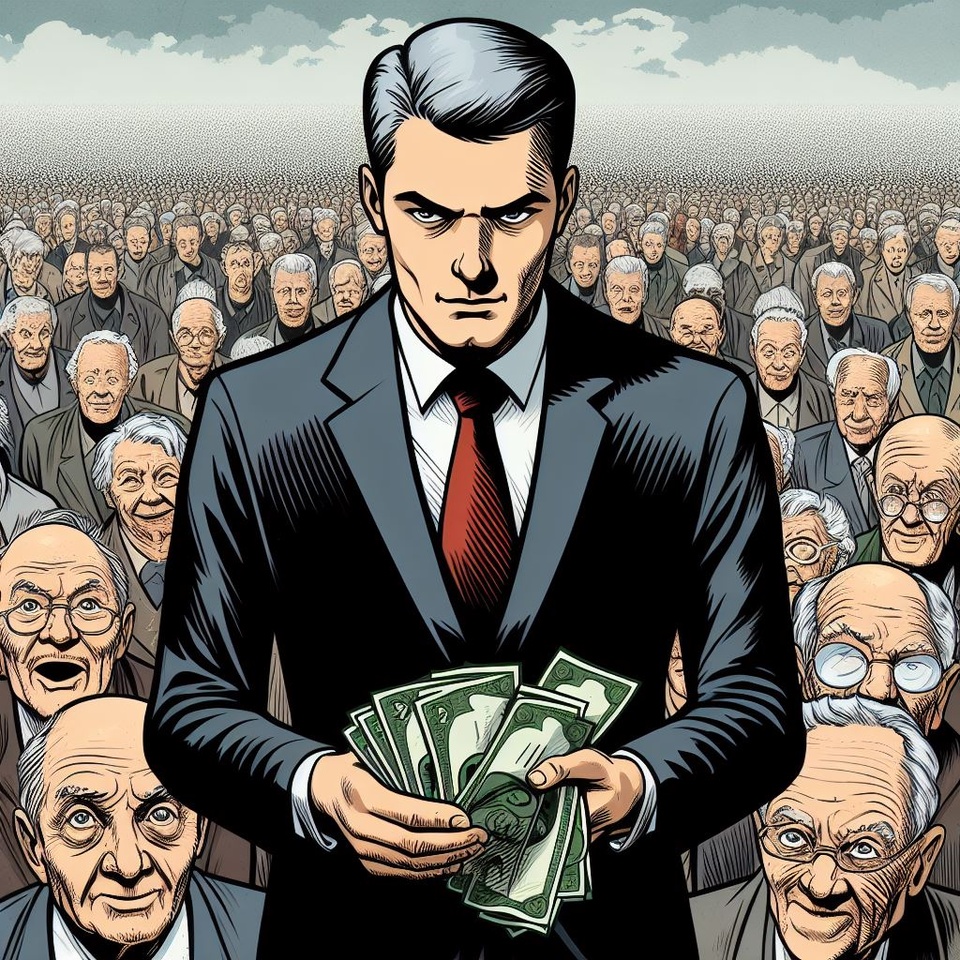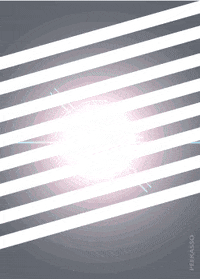Quartalszahlen am 03.11.2022…
Lasst gerne ein Follow da, denn…⤵️
…bei 5.000 Follower wird es zusammen mit getquin, ein kleines Dankeschön für die Community geben. Dieser Beitrag könnte aber schon morgen entstehen. Ich freue mich drauf! Auf zu den Quartalszahlen von heute. In diesem Beitrag, den ich jeden Morgen poste, hatte ich angekündigt, was heute so passiert:
https://app.getquin.com/activity/ydggsOLkpb?lang=de&utm_source=sharing
$SBUX (+0,09 %)
Starbucks:
übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,81 die Analystenschätzungen von $0,73. Umsatz mit $8,4 Mrd. über den Erwartungen von $8,33 Mrd.
$PYPL (-0,5 %)
PayPal:
übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,08 die Analystenschätzungen von $0,96. Umsatz mit $6,85 Mrd. über den Erwartungen von $6,82 Mrd.
$DBX (+0,22 %)
Dropbox:
übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,43 die Analystenschätzungen von $0,38. Umsatz mit $591 Mio. über den Erwartungen von $586,15 Mio.
$DASH (+3,29 %)
DoorDash:
verfehlt im dritten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,77 die Analystenschätzungen von -$0,55. Umsatz mit $1,7 Mrd. über den Erwartungen von $1,62 Mrd.
$GPRO (+0,25 %)
GoPro:
übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,19 die Analystenschätzungen von $0,17. Umsatz mit $305 Mio. über den Erwartungen von $298,85 Mio.
$MSI (+0,28 %)
Motorola Solutions:
übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $3,00 die Analystenschätzungen von $2,88. Umsatz mit $2,37 Mrd. über den Erwartungen von $2,31 Mrd.
$HOT (+0,75 %)
Hochtief:
hat im dritten Quartal einen Umsatz von 7,18 Milliarden Euro (Vorjahr 5,32 Mrd) erzielt und unter dem Strich 115 Millionen Euro (Vorjahr 99,8 Mio) verdient. Der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis beträgt 6,5 Milliarden (Vorjahr 7,5 Mrd).
$K
Kellogg Co.:
übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,01 die Analystenschätzungen von $0,97. Umsatz mit $3,95 Mrd. über den Erwartungen von $3,77 Mrd.
$RCL (+0,49 %)
Royal Caribbean Cruises Ltd.:
übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,26 die Analystenschätzungen von $0,19. Umsatz mit $3 Mrd. über den Erwartungen von $2,99 Mrd.
$UAA (+0,31 %)
Under Armour Inc.:
übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,20 die Analystenschätzungen von $0,10. Umsatz mit $1,57 Mrd. über den Erwartungen von $1,42 Mrd.
$W (+0,36 %)
Wayfair Inc.:
verfehlt im dritten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$2,11 die Analystenschätzungen von -$2,05. Umsatz mit $2,8 Mrd. unter den Erwartungen von $2,82 Mrd.
$PTON (-0,65 %)
Peloton Interactive Inc.:
verfehlt im ersten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$1,20 die Analystenschätzungen von -$0,64. Umsatz mit $616,5 Mio. unter den Erwartungen von $637,07 Mio.
$DDOG (+0,7 %)
Datadog Inc.:
übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,23 die Analystenschätzungen von $0,16. Umsatz mit $437 Mio. über den Erwartungen von $415,07 Mio.
$MRNA (-0,28 %)
Moderna Inc.:
verfehlt im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,53 die Analystenschätzungen von $4,81. Umsatz mit $3,36 Mrd. unter den Erwartungen von $4,63 Mrd.
$CROX (+13,67 %)
Crocs Inc.:
verfehlt im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,50 die Analystenschätzungen von $2,62. Umsatz mit $985,1 Mio. über den Erwartungen von $942,52 Mio.
$IRM (+1,31 %)
Iron Mountain Inc.:
übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,48 die Analystenschätzungen von $0,44. Umsatz mit $1,29 Mrd. unter den Erwartungen von $1,31 Mrd.
$SBS (-2,42 %)
STRATEC:
erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Umsatz von €207,7 Mio (vorläufig: €207,7 Mio), eine bereinigte Ebit-Marge von 18,3 % (vorläufig: 18,3 %) und einen Nettogewinn (bereinigt) von €29,5 Mio (VJ: €40,6 Mio). Ausblick bestätigt.
$BOSS (-0,18 %)
HUGO BOSS:
erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €933 Mio (VJ: €755, Analystenprognose: €903,4 Mio), ein Ebit von €92 Mio (VJ: €85 Mio, Prognose: €88,1 Mio) und ein Konzernergebnis von €58 Mio (VJ: €53 Mio, Prognose: €56,6 Mio). Im Ausblick auf 2022 erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von €3,5 bis €3,6 Mrd (bisher: €3,3 bis €3,5 Mrd) und ein Ebit von €310 bis €330 Mio (bisher: €285 bis €310 Mio).
$SGL (+1,5 %)
SGL CARBON:
erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Umsatz von €853,9 Mio (VJ: €743,5 Mio), ein Ebitda (bereinigt) von €136,1 Mio (VJ: €108,5 Mio) und einen Nettogewinn nach Minderheiten von €70,6 Mio (VJ: €42,6 Mio). Prognose bestätigt.
$PFV (+0,06 %)
Pfeiffer Vacuum:
erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Auftragseingang von €866,5 Mio (vorläufig: €866,5 Mio), einen Umsatz von €668,7 Mio (vorläufig: €668,7 Mio), ein Ebit von €94 Mio (vorläufig: €94 Mio) und einen Nettogewinn von €66,6 Mio (VJ: €52,1 Mio). Prognose vom 17. Oktober für Umsatz und Ebit-Marge bestätigt.
$HNR1 (+1,59 %)
Hannover Rück:
erzielt im 3. Quartal Bruttoprämien im Volumen von €8,91 Mrd (VJ: €7,15 Mrd, Analystenprognose: €8,02 Mrd), eine Combined Ratio von 99,6 % (VJ: 101,5 %, Prognose: 99,6 %), ein Kapitalanlageergebnis von €400,3 Mio (VJ: €491,1 Mio), ein Ebit von €408,9 Mio (VJ: €324,5 Mio, Prognose: €399 Mio) und einen Nettogewinn von €221,9 Mio (VJ: €185,4 Mio, Prognose: €311 Mio). Im Ausblick auf 2022 sieht das Unternehmen das Nettoergebnis im unteren Bereich der Spanne von €1,4 bis €1,5 Mrd, Gewinnziel für 2022 bleibt erreichbar.
$UN01
Uniper:
erzielt im 1. bis 3. Quartal ein Nettoergebnis von -€40 Mrd (VJ: -€4,8 Mrd), Fehlbetrag enthält €10 Mrd realisierte Kosten für Ersatzmengen; wirtschaftliche Nettoverschuldung bei €10,91 Mrd (VJ: €0,324 Mrd), Fehlbetrag inklusive €31 Mrd erwartete Verluste und Rückstellungen; bereinigtes Nettoergebnis von -€3,22 Mrd (vorläufig: -€3,2 Mrd, Vorjahr: +€0,487 Mrd), bereinigtes Ebit von -€4,75 Mrd (vorläufig: -€4,8 Mrd, Vorjahr: +€0,614 Mrd). Konkrete Ergebnisprognose derzeit bis auf Weiteres unmöglich.
$O2D (+1,16 %)
Telefonica Deutschland:
erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €2,085 Mrd (VJ: €1,967 Mrd, Analystenprognose: €2,030 Mrd), einen Serviceumsatz von €1,47 Mrd (VJ: €1,42 Mrd), ein bereinigtes OIBDA von €642 Mio (VJ: €613 Mio, Prognose: €640,5 Mio). Im Ausblick auf 2022 sollen Umsatz und OIBDA gegenüber dem Vorjahr nun im "unteren mittleren einstelligen Prozentbereich" (bisher: im niedrigen mittleren einstelligen Prozentbereich") liegen.
$BMW (-1,65 %)
BMW:
erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €37,18 Mrd (VJ: €27,47 Mrd, Analystenprognose: €35,53 Mrd), ein Ebit von €3,68 Mrd (VJ: €2,88 Mrd, Prognose: €3,5 Mrd), ein EBT von €4,1 Mrd (VJ: €3,42 Mrd) und ein Nettoergebnis von €3,18 Mrd (VJ: €2,58 Mrd). Ausblick bestätigt.
$ZAL (-0,94 %)
Zalando:
erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von 2,34 Mrd (VJ: €2,28 Mrd), ein Ebit (bereinigt) von €13,5 Mio (VJ: €9,8 Mio) und ein Nettoergebnis von -€35,4 Mio (VJ: -€8,4 Mio); Zahl der aktiven Kunden wächst um 8 % und übertrifft erstmals 50 Mio. Ausblick bestätigt
$COP (+0,67 %)
CompuGroup:
erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Umsatz von €802 Mio (vorläufig: €802 Mio), ein Ebitda von €166 Mio (vorläufig: €166 Mio) und einen Nettogewinn von €59,8 Mio (VJ: 56,6 Mio). Ausblick bestätigt.
$RAA (-0,85 %)
RATIONAL:
erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €274,2 Mio (VJ: €207 Mio, Analystenprognose: €270 Mio), ein Ebit von €70,3 Mio (VJ: €49,7 Mio, Prognose: €64,4 Mio), eine Ebit-Marge von 25,6 % (VJ: 24,0 %) und ein Ergebnis nach Steuern von €53,8 Mio (VJ: €37,8 Mio). Prognose bestätigt.
$KCO (+0,09 %)
Klöckner & Co:
erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €2,37 Mrd (VJ: €2,0 Mrd), ein Ebitda (bereinigt) von €16 Mio (VJ: €277 Mio) und ein Konzernergebnis von -€22 Mio (VJ: +185 Mio). Ausblick bestätigt.
#quartalszahlen
#boerse
#börse
#aktien
#paypal
#starbucks
#sandp500
#communityfeedback
#community